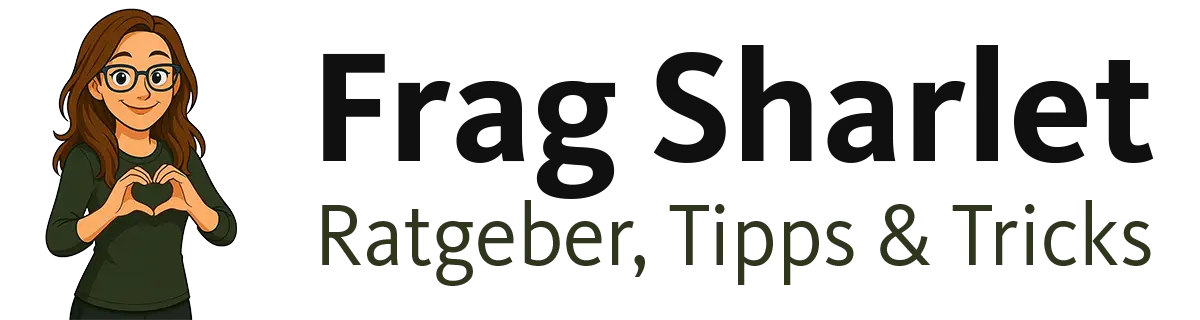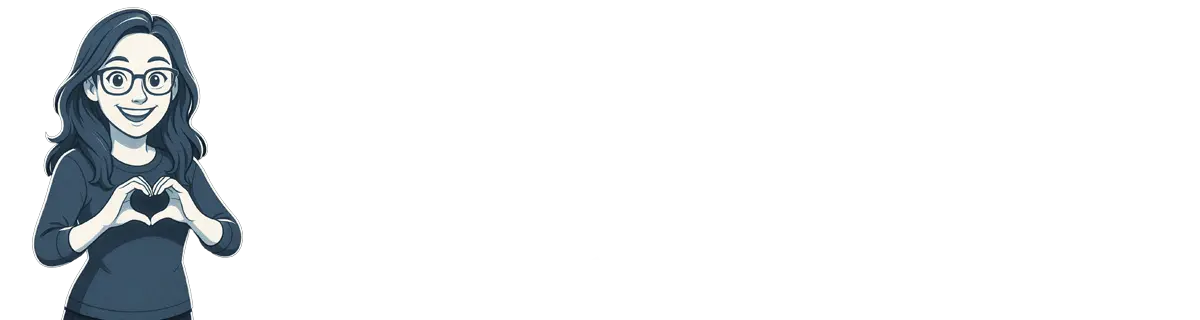Inhaltsverzeichnis
Streit über Politik am Küchentisch ist oft mehr als ein harmloser Schlagabtausch: Eine aktuelle Langzeitstudie der Universität Padua und des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung (MPIDR) macht deutlich, dass politische Differenzen in Partnerschaften das Risiko einer Trennung spürbar erhöhen. Untersucht wurden dafür über drei Jahrzehnte hinweg Daten von Paaren im Vereinigten Königreich, die sowohl Parteipräferenzen als auch Haltungen zu politischen Großereignissen wie dem Brexit abbilden.
Politische Einigkeit wirkt wie ein Kleber
Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Paare, die dieselbe Partei unterstützen oder ähnliche politische Grundhaltungen teilen, trennen sich deutlich seltener. Lag die jährliche Trennungsrate bei politisch gleichgesinnten Paaren bei rund 0,77 Prozent, stieg sie bei Paaren mit unterschiedlichen Parteipräferenzen auf 1,06 Prozent – ein Anstieg von immerhin 38 Prozent. Noch deutlicher zeigte sich der Effekt beim Brexit: Einigkeit in dieser Frage bedeutete eine Trennungswahrscheinlichkeit von etwa 1,1 Prozent, Uneinigkeit erhöhte das Risiko auf 1,8 Prozent pro Jahr.
Damit sind politische Einstellungen statistisch betrachtet ein mindestens ebenso wichtiger Stabilitätsfaktor wie ähnliche Vorstellungen bei Finanzen, Kindererziehung oder Haushaltsfragen. Die Studie deutet zudem an, dass nicht unbedingt die konkrete Parteifarbe entscheidend ist, sondern das Gefühl, grundsätzlich auf einer Linie zu sein. Wer gemeinsam lacht, diskutiert und am Ende ähnliche Schlüsse zieht, bleibt eher zusammen.
Was politische Streitkultur für Beziehungen bedeutet
Die Forschenden warnen zugleich davor, die Ergebnisse falsch zu interpretieren. Politische Diskussionen können Partnerschaften durchaus bereichern, wenn sie respektvoll geführt werden und beiden helfen, den eigenen Horizont zu erweitern. Kritisch wird es vor allem dann, wenn Überzeugungen so stark auseinandergehen, dass gemeinsame Werte nicht mehr erkennbar sind. Dann verliert die Beziehung häufig ihr Fundament.
Alessandro Di Nallo, einer der Studienautoren vom MPIDR, fasst es in der Studie so zusammen: „Die Politik beeinflusst nicht nur Familien, sondern Familien beeinflussen auch die Gesellschaft. Gemeinsame politische Werte können Partnerschaften stärken, gravierende Unterschiede sie aber ebenso zerstören.“
Ein Spiegel für gesellschaftliche Polarisierung
Die Ergebnisse der Forscher legen nahe, dass die zunehmende Polarisierung in vielen Ländern nicht nur Parlamente und Wahlabende betrifft, sondern längst auch die intimsten Bereiche des Lebens erreicht hat. Paare, die sich über Brexit, Migration oder Sozialstaat zerstreiten, tragen dazu bei, dass politische Konfliktlinien immer tiefer ins Private eingreifen. Gleichzeitig könnten stabile, politisch gleichgerichtete Partnerschaften wiederum gesellschaftliche Gräben verfestigen, weil sie weniger geneigt sind, andere Perspektiven ins eigene Leben zu lassen.
Interessant ist dabei auch ein Detail der Untersuchung: Politisches Desinteresse oder eine vage Haltung führten ebenfalls häufiger zu Trennungen. Offenbar gibt selbst das geteilte „Nicht-Interessiert-Sein“ weniger Halt, als viele annehmen würden.